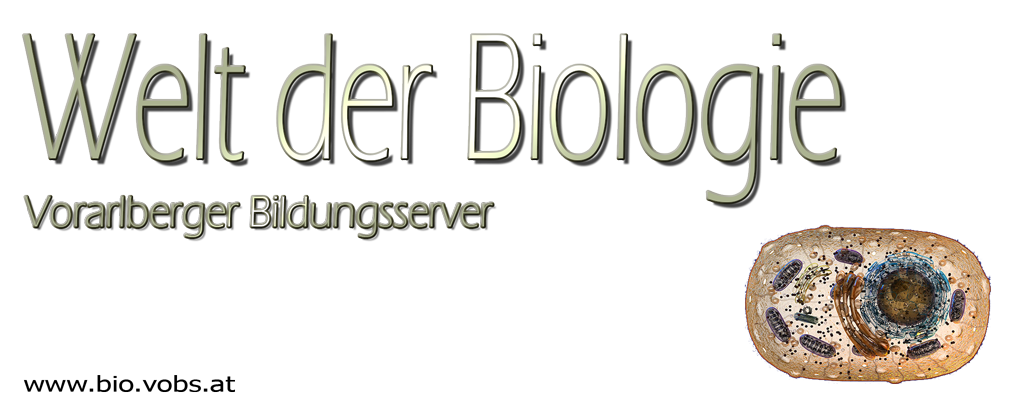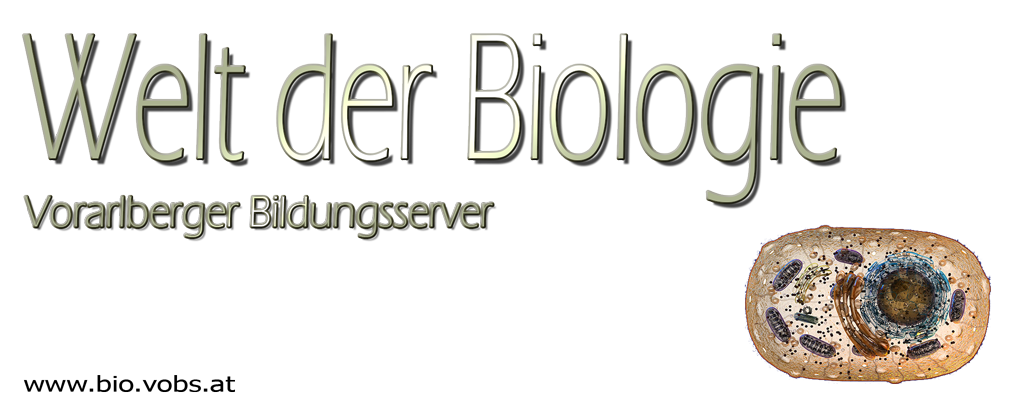EinzellerEine Auswahl tierischer und (partiell) pflanzlicher
Einzeller.
Man gliedert das Tierreich in Einzeller (Urtierchen, "Protozoen"
oder "Protozoa") und Vielzeller (Metazoen oder Metazoa). Einzeller
findet man fast überall, wo Wasser ist. Sie sind ein wichtiger Bestandteil
des Planktons und Bewohner aller Lebensräume, die genügend feucht
sind. Neben den frei lebenden Einzellern gibt es viele, die als Symbionten
oder Parasiten' in den verschiedenen Körperflüssigkeiten, Geweben
oder Zellen anderer Lebewesen ihren Lebensraum haben.
Geißeltierchen (Flagellaten)
 Bild: Euglena (aus Encarta 2000) Flagellaten sind Mikroorganismen,
die sich durch eine oder mehrere Geißeln fortbewegen. Das
Augentierchen ("Euglena", Schönauge) ist ein typischer Planktonvertreter
unserer Teiche und Tümpel. Der spindelförmige, etwa 0,05 mm
große Körper besteht aus einer einzigen Zelle. Am Vorderende
liegt ein Säckchen, das mit einem Schlund nach außen mündet;
auf seinem Grund entspringen zwei Geißeln. Eine ist eine lange Bewegungsgeißel.
Durch kreisende oder wellenförmige Bewegung zieht sie die Zelle durchs
Wasser. Am Schlund liegt der rot gefärbte "Augenfleck",
der dieser Geißelalge den Namen gegeben hat. Mit seiner Hilfe
kann die Zelle hell und dunkel unterscheiden.
Bild: Euglena (aus Encarta 2000) Flagellaten sind Mikroorganismen,
die sich durch eine oder mehrere Geißeln fortbewegen. Das
Augentierchen ("Euglena", Schönauge) ist ein typischer Planktonvertreter
unserer Teiche und Tümpel. Der spindelförmige, etwa 0,05 mm
große Körper besteht aus einer einzigen Zelle. Am Vorderende
liegt ein Säckchen, das mit einem Schlund nach außen mündet;
auf seinem Grund entspringen zwei Geißeln. Eine ist eine lange Bewegungsgeißel.
Durch kreisende oder wellenförmige Bewegung zieht sie die Zelle durchs
Wasser. Am Schlund liegt der rot gefärbte "Augenfleck",
der dieser Geißelalge den Namen gegeben hat. Mit seiner Hilfe
kann die Zelle hell und dunkel unterscheiden.
Beispiel: "Euglena" ist eine Brückenform zwischen
Pflanzen- und Tierreich:
Ein Bestandteil des Zytoplasmas sind die grün gefärbten Farbstoffträger
oder "Chloroplasten". Mit ihrer Hilfe bauen die Zellen aus
C02 und H20 unter Lichteinwirkung körpereigene
organische Stoffe auf ("Photosynthese"). Organismen mit dieser Ernährungsweise
bezeichnet man als autotroph.
Euglenen können aber auch wie ein Tier organische Stoffe aufnehmen,
um daraus Energie zu gewinnen. Entweder werden gelöste Nahrungsbestandteile
über die gesamte Körperoberfläche aufgenommen, oder es
werden feste Teilchen vom Protoplasma umflossen und in kleine Bläschen,
sogenannte Nahrungsvakuolen, aufgenommen und dort verdaut.
Organismen, die bereits vorhandene organische Substanzen als Nahrung benötigen,
bezeichnet man als heterotroph. Euglena kann zwischen autotropher
und heterotropher Ernährung sozusagen umschalten.
Wurzelfüßer ("Rhizopoden")
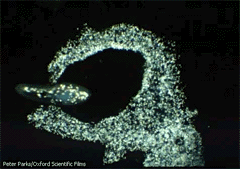 Bild: Amöbe umfließt Beute (aus Encarta 2000) Charakteristische
Süßwasservertreter dieser Gruppe sind die Wechseltierchen oder
Amöben. Sie sind farblose Protoplasmatröpfchen ohne feste Zellwand
und bestehen aus einem körnigen, dünnflüssigen Plasma.
Sie führen Kriechbewegungen aus, wobei lappenförmige oder verzweigte
Zellausstülpungen entstehen, in die das ganze Zellplasma hineinströmen
kann, die aber nach Rückfließen des Plasmas in die Zelle wieder
eingezogen werden können. Diese vorübergehenden Plasmaausstülpungen
bezeichnet man als Scheinfüßchen, die dadurch mit dauernder
Gestaltveränderung verbundene Bewegung amöboide Bewegung.
Bild: Amöbe umfließt Beute (aus Encarta 2000) Charakteristische
Süßwasservertreter dieser Gruppe sind die Wechseltierchen oder
Amöben. Sie sind farblose Protoplasmatröpfchen ohne feste Zellwand
und bestehen aus einem körnigen, dünnflüssigen Plasma.
Sie führen Kriechbewegungen aus, wobei lappenförmige oder verzweigte
Zellausstülpungen entstehen, in die das ganze Zellplasma hineinströmen
kann, die aber nach Rückfließen des Plasmas in die Zelle wieder
eingezogen werden können. Diese vorübergehenden Plasmaausstülpungen
bezeichnet man als Scheinfüßchen, die dadurch mit dauernder
Gestaltveränderung verbundene Bewegung amöboide Bewegung.
Als Nahrung dienen den Amöben kleinste Mikroorganismen (Bakterien,
Algen) oder verwesende Tier- und Pflanzenreste. Die Nahrungsteilchen werden
von den Scheinfüßchen umflossen und im Plasma in Nahrungsvakuolen
eingeschlossen. Süßwasseramöben besitzen eine pulsierende
Vakuole zur Ausscheidung von Wasser und Stoffwechselabbauprodukten.
Die Amöben (siehe Bild) vermehren sich ungeschlechtlich
durch Zellteilung, manche Wurzelfüßer auch durch flagellatenähnliche
Fortpflanzungsstadien. Unter ungünstigen Lebensbedingungen entstehen
Zysten. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung verschmelzen zwei Zellen
entweder im amöboiden Zustand oder in Form begeißelter Gameten.
Manche Amöben leben im Darm höherer Tiere oder des Menschen
als harmlose, Bakterien fressende Mitbewohner oder als krankheitserregende
Parasiten. In tropischen und subtropischen Gebieten ruft eine Amöbe
die "Weiße Ruhr" hervor.
Wimpertierchen ("Ciliaten")
Der Besitz eines Wimperkleides ist das gemeinsame Kennzeichen
aller Wimpertierchen oder Ciliaten, die auch auf Grund der Tatsache, dass
man sie in Heuaufgüssen verbreitet findet, Aufgusstierchen oder lateinisch
Infusorien genannt werden.
 Bild: Paramaecium (aus Encarta 2000) Ein Beispiel für einen hoch
differenzierten Einzeller ist das Pantoffeltierchen. Wegen
seiner Größe von 0,3 mm kann es mit freiem Auge noch gerade
als Pünktchen erkannt werden. Es findet sich als Bakterienfresser
häufig in verunreinigten Gewässern.
Bild: Paramaecium (aus Encarta 2000) Ein Beispiel für einen hoch
differenzierten Einzeller ist das Pantoffeltierchen. Wegen
seiner Größe von 0,3 mm kann es mit freiem Auge noch gerade
als Pünktchen erkannt werden. Es findet sich als Bakterienfresser
häufig in verunreinigten Gewässern.
Sein länglicher, spindelförmiger Körper erhält durch
eine verfestigte äußerste Plasmaschichte eine charakteristische
pantoffelförmige Gestalt und trägt ein dichtes Wimperkleid.
Zum Herbeistrudeln und Aufnehmen der Nahrung dient im vorderen Teil
des Körpers eine flache Grube, die mit kräftigeren Wimpern ausgekleidet
ist, das Mundfeld. Auf seinem Grund öffnet sich das Plasmahäutchen
zum Zellmund, durch den die herbeigestrudelten Nahrungsteilchen in einen
kleinen Kanal im Protoplasma, dem Zellschlund, und am Ende des
Schlundes in die dort entstehenden Nahrungsvakuolen gelangen. Diese
Vakuolen wandern durch das Plasma, verdauen die Nahrung und stoßen
schließlich die unverdaulichen und wertlosen Reste an einer bestimmten
Stelle der Zelloberfläche, dem Zellafter, aus dem Zellkörper
wieder aus.
Sporentierchen ("Sporozoa")
Die Vertreter dieser Gruppe der tierischen Einzeller leben ausschließlich
als Parasiten und nehmen durch ihre Zelloberfläche nur gelöste
Nahrung auf. Daher benötigen sie keine Verdauungs- und keine Bewegungsorganellen.
Ihr Name ist von der Sporenbildung abgeleitet, einer ungeschlechtlichen
Vermehrung durch Vielzellbildung, die in einem komplizierten Entwicklungsgang
eingeschaltet ist.
 Bild: Malariaerreger (aus Encarta 2000) Durch Sporentierchen wird in den
Tropen und Subtropen die Malaria(durch Plasmodium vivax)hervorgerufen.
Sie ist gekennzeichnet durch regelmäßige Fieberanfälle
(Wechselfieber), die durch eine periodische Vermehrung der Parasiten in
den roten Blutkörperchen ausgelöst werden; ihre Übertragung
erfolgt durch den Stich infizierter Fiebermücken.
Bild: Malariaerreger (aus Encarta 2000) Durch Sporentierchen wird in den
Tropen und Subtropen die Malaria(durch Plasmodium vivax)hervorgerufen.
Sie ist gekennzeichnet durch regelmäßige Fieberanfälle
(Wechselfieber), die durch eine periodische Vermehrung der Parasiten in
den roten Blutkörperchen ausgelöst werden; ihre Übertragung
erfolgt durch den Stich infizierter Fiebermücken.
Bei Reisen in malariaverseuchte Gebiete sollte man sich rechtzeitig
durch Einnahme von geeigneten Medikamenten (Malariaprophylaxe) und durch
Vermeidung von Mückenstichen (Moskitonetz, chemische Schutzmittel)
schützen.
Der Entwicklungsgang des Malariaerregers beginnt, wenn die Infektionskeime
(Sichelkeime) beim Stich der Fiebermücke (Anopheles)
mit deren Speichel in das Blut des Menschen kommen.
In der ungeschlechtlichen Phase wachsen die Sichelkeime in den Zellen
der Leber zu vielkernigen, in viele einkernige Teilsprösslinge zerfallende
Gebilde heran (Inkubationszeit, geringe medikamentöse Beeinflussbarkeit).
Wiederholter Befall durch Teilsprösslinge, bis diese in der ungeschlechtlichen
Phase in rote Blutkörperchen eindringen und in ihnen "Merozoiten" bilden. Diese befallen immer wieder rote Blutkörperchen, zeitlich parallel verlaufen die Fieberwellen.
Zellfamilien - (Übergang zu den Vielzellern)
Vereinigungen gleichwertiger Zellen ohne Arbeitsteilung bezeichnet
man als Zellfamilien oder Zellkolonien.
Entwickeln sich die Zellen eines Verbandes unterschiedlich, übernehmen
sie verschiedene Aufgaben, kommt es also zu einer Arbeitsteilung oder
Differenzierung (Spezialisierung der Zellen), dann entstehen vielzellige
Organismen.
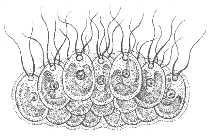 Bild links: Gonium (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Flagellaten,
zu denen auch die Kugelalge gehört, weist Übergänge zwischen
Koloniebildung und Vielzelligkeit auf.
Bild links: Gonium (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Flagellaten,
zu denen auch die Kugelalge gehört, weist Übergänge zwischen
Koloniebildung und Vielzelligkeit auf. 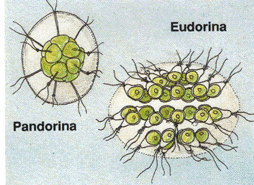
Bild rechts: Eudorina und Pandorina (aus Schirl: Über die
Natur - Verl. Dorner)
Hier gibt es einerseits bestimmt gestaltete Kolonien vollkommen gleichwertiger
Zellen, dann Zellverbände mit Differenzierungen in größere
teilungsfähige Fortpflanzungszellen und kleinere Körperzellen,
die ihre Teilungsfähigkeit verloren haben, dafür aber für
die Durchführung der Stoffwechselvorgänge zuständig sind,
und schließlich die Kugelalge selbst, in der sich auch die Körperzellen
unterschiedlich zu entwickeln beginnen. Daher ist diese Kugelalge als
ein Beispiel eines einfachen vielzelligen Individuums aufzufassen.
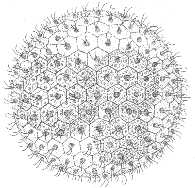 Bild: Volvox (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Kugelalge oder
Volvox
Bild: Volvox (aus Mandl: Organismus und Umwelt) Die Kugelalge oder
Volvox
ist eine bis 1 mm große und daher mit freiem Auge sichtbare grüne
Hohlkugel, die sich unter drehenden Bewegungen im Wasser fortrollt. Ihre
einschichtige Wand enthält bis zu 20 000 Zellen mit je zwei Geißeln,
zwei kontraktilen Vakuolen, einem Augenfleck und einem Farbstoffträger.
Die Arbeitsteilung besteht darin, dass nur noch ein geringer Teil
der Zellen als Fortpflanzungszellen teilungsfähig und vermehrungsfähig
bleibt, die große Masse der Zellen hingegen als Körperzellen
der Fotosynthese und Bewegung dient und ihre Teilungsfähigkeit verloren
hat. Alle Zellen sind durch Plasmabrücken miteinander verbunden.
Innerhalb der Körperzellen lassen sich die Zellen des vorderen Kugelpoles
durch größere Augenflecke von den Zellen des hinteren Poles
unterscheiden.
Die ungeschlechtliche Vermehrung von Volvox erfolgt
durch Tochterkugeln, die in der Mutterkugel heranwachsen und durch Zerfall
der Mutterkugel frei werden. Nach dem Freiwerden der Tochterkugeln stirbt
die Mutterkugel ab. ("Die erste Leiche der Biologie").
Die geschlechtliche Fortpflanzung erfolgt durch
Eibefruchtung. In der Wand der Hohlkugel werden einige Zellen zu großen
unbeweglichen Eizellen, in anderen entstehen durch Vielzellteilung kleine
bewegliche, mit Geißeln versehene Samenzellen oder Spermatozoiden.
Bilder:
Mandl "Organismus und Umwelt", Verl. ÖBV Pädagogischer
Verlag und Encarta 2000.
|