Selektion: Anpassung an Umweltbedingungen
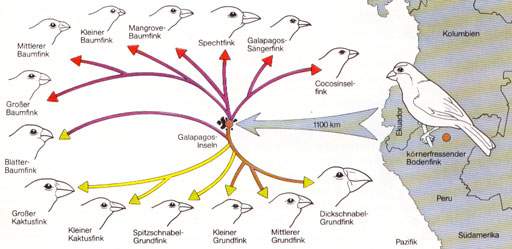
Die Darwinfinken sind eine Unterfamilie der Ammern, die mit vier
Gattungen und 13 Arten nur auf den Galápagos-Inseln und mit
einer Spezies auf der 800 Kilometer nordöstlich gelegenen Kokos-Insel
vorkommen. Aufgrund ihres beschränkten Vorkommens bezeichnet
man sie auch als Galapagosfinken. Sie gehen entwicklungsgeschichtlich
auf eine Stammart zurück, die Ende des Tertiärs (vor etwa
zehn Millionen Jahren) vom südamerikanischen Festland auf die
Inseln verdriftet wurde. Aus dieser Stammform entwickelten sich in
Anpassung an unterschiedliche Umweltbedingungen verschiedene Arten,
die vor allem aufgrund des wichtigen Konkurrenzfaktors Nahrung unterschiedliche
Ernährungsstrategien entwickelten und somit verschiedene ökologische
Nischen bildeten.
Ihre Spezialisierungen drücken sich vor allem in unterschiedlichen
Schnabelkonstruktionen und der Körpergröße aus. Das
Spektrum reicht von langen, spitzen Schnäbeln der Insektenfresser,
die an Laubsänger erinnern, bis zu kernbeißerähnlichen
Schnäbeln, mit denen sich harte Körner und Nüsse knacken
lassen. Eine besondere Gruppe der Darwinfinken sind die Spechtfinken,
die als Werkzeug bei der Nahrungssuche abgebrochene Ästchen oder
Opuntienstacheln verwenden, mit denen sie Larven aus Löchern
in Baumstämmen holen. Damit haben sie auf den Galapagos-Inseln
ähnliche Nischen gebildet wie Spechte in anderen Lebensgemeinschaften.
Selektion: Konvergenz
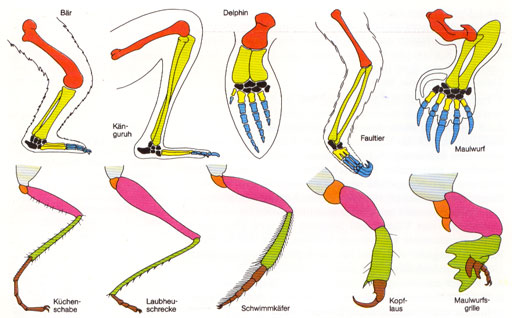
Unter Konvergenz versteht man in der Evolutionsbiologie die
Entwicklung ähnlicher Merkmale bei nicht verwandten Arten mit
ähnlicher Lebensweise. Homologe Strukturen haben einen
gemeinsamen evolutionären Ursprung und oft eine unterschiedliche
Funktion. Im Gegensatz dazu besitzen analoge Strukturen, die Konvergenzen
begründen, eine ähnliche Funktion, sind aber unabhängig
voneinander entstanden. Sie sind daher auch kein Merkmal für
den Verwandtschaftsgrad von Organismen.
Manche Säugetiere haben ihre Haare unabhängig voneinander
zu Stacheln entwickelt, so die Igel unter den Insektenfressern, die
Stachelschweine unter den Nagetieren und die Ameisenigel unter den
Kloakentieren. Betrifft die Ausbildung der Konvergenz mehrere Organe,
so dass unter Einfluss gleicher Lebensbedingungen zum Teil sehr ähnliche
Arten ohne Verwandtschaftsbeziehungen entstehen, spricht man auch
von Lebensformtypen. Ein Beispiel hierfür ist die Ausbildung
von stromlinienförmigen Körpern bei schnellschwimmenden
aquatischen Organismen. Dieses Merkmal kommt in allen Wirbeltiergruppen
vor und wurde meist zusammen mit einer Endflosse als Antriebsorgan
entwickelt.
Konvergente Entwicklung führt vor allem in geographisch
voneinander getrennten Regionen zu ähnlichen (nicht verwandten)
Arten. Die ökologische Nische der nektarsaugenden Vögel
wird in Amerika von den Kolibris, in Afrika von den Nektarvögeln,
auf Hawaii von den Kleidervögeln und in Australien von den Honigfressern
besetzt, die alle unterschiedlichen Familien oder Ordnungen entstammen.
Bei Pflanzen stellt die Entwicklung der Stammsukkulenz ein Beispiel
für eine Konvergenz dar. Während sie in Amerika von Kakteen
ausgebildet wird, kommen in Afrika entsprechend gebaute Wolfsmilchgewächse
vor und auf Madagaskar die nur hier existierenden „Kakteenbäume”,
die Didiereaceen.
Übergangsformen: Augenmodelle
Viele Übergangsformen zwischen den einzelnen Organen sind im Laufe
der Evolution verloren gegangen, aber beim Auge sind so gut wie alle
Übergangsformen zwischen dem Flachauge und Linsenauge noch zu
finden. Es wird ja nicht das
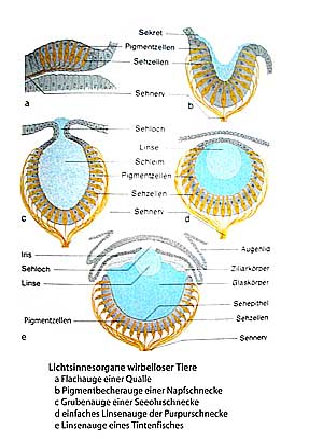 1.)
Das Flachauge (bei Quallen, Seesternen, Ringelwürmern) 1.)
Das Flachauge (bei Quallen, Seesternen, Ringelwürmern)
Flachaugen enthalten nur wenige Sehzellen und können aufgrund
eines fehlenden optischen Apparates (z.B. Blende, Linse usw.) nur
die ungefähre Richtung des einfallenden Lichtes bestimmen.
2.) Das Pigmentbecherauge
Beim Pigmentbecherauge ist der Sehfleck schalenförmig eingesenkt.
Dadurch wird das Sehfeld zwar verkleinert, dafür kann die Richtung
der Lichtquelle besser festgestellt werden.
Es kann auch eine ungefähre Vorstellung von Hell-Dunkel-Verteilung
vermittelt werden.
3.) Das Grubenauge
Das Grubenauge leitet sich vom Pigmentbecherauge ab. Wenn die Einsenkung
eine Blasenform annimmt und die Sehöffnung bis auf ein kleines
Loch verengt wird, spricht man von einem Grubenauge. Bei diesem Auge
wird ein Bild auf den Augenhintergrund geworfen.
Das erzeugte Bild ist weder lichtstark noch besonders scharf. Je enger
das Sehloch ist, desto schärfer ist das Bild, gleichzeitig aber
auch umso lichtschwächer. Die Bildschärfe wird also immer
auf Kosten des Lichteinfalls erhöht.
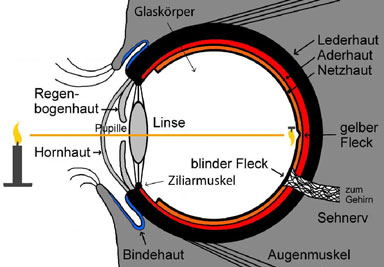 4.)
Das Linsenauge 4.)
Das Linsenauge
Das Auge ist aus 4 Schichten aufgebaut: Als erste und äußerste
Schicht bildet die widerstandsfähige harte Augenhaut die Wand
des Auges. Der gewölbte und durchsichtige Teil der Aderhaut bezeichnet
man als Hornhaut (Kornea); die Stelle durch die das Licht eindringen
kann.
Auf der Innenseite der harten Augenhaut liegt die Aderhaut.
Es folgt die schwarze Pigmenthaut, die dazu dient um Reflexionen des
einfallenden Lichtes zu verhindern (verantwortlich dafür ist
der dunkle Farbstoffkörper (Pigment) in den Zellen dieser Schicht.
Die innerste Schicht vor der Hohlkugel des Augapfels ist die Netzhaut
oder Retina.
Hinter der Hornhaut liegt die Iris oder auch Regenbogenhaut, welche
wiederum vor der Linse aufliegt. Diese umschließt die Pupille.
Die Pupille die dient als Instrument zur Regelung des Lichteinfalls.
Je höher die Lichtintensität, desto enger wird sie.
Die Vielfalt
Über die Artenvielfalt aller Lebewesen auf der Erde lassen sich
nur Vermutungen anstellen. Während man beispielsweise über
die Diversität der Säugetiere mit etwa 4000 Spezies gut
orientiert ist, wurde wahrscheinlich die Mehrzahl der Arten von Insekten,
wirbellosen Tiefseebewohnern und Mikroorganismen noch gar nicht entdeckt.
Heute sind rund 1,5 Millionen Tier und 1 Million Pflanzenarten
bekannt. Grobe Schätzungen über die gesamte Mannigfaltigkeit
reichen von drei Millionen bis zu 100 Millionen Spezies. In Sri Lanka
wurden beispielsweise bei der Erforschung des Kronendaches des Regenwaldes
über 100 unbekannte Froscharten entdeckt – bis dahin waren
für Sri Lanka nur 18 Froscharten beschrieben worden (Science,
2002).
In den Tropen ist die biologische Vielfalt am größten,
global gesehen nimmt sie vom Äquator zu den Polarregionen ab.
Das World Conservation Monitoring Centre (WCMC) der Vereinten Nationen
identifizierte 25 so genannte Hot spots (Gebiete mit besonders hoher
Artenvielfalt), z. B. die tropischen Anden, Madagaskar und Inselgruppen
wie die Karibik, die Philippinen und die indonesischen Sunda-Inseln.
Auch die Mittelmeerküste gehört mit ihrer besonderen Vielfalt
an heimischen Pflanzenarten zu diesen Hot spots. In Deutschland leben
nach einer 2004 veröffentlichten Erfassung des Bundesamtes für
Naturschutz rund 48 000 Tierarten, davon machen die Insekten über
33 000 Arten aus.
Arten sind nicht stabil, sie sind in beständiger Veränderung.
So gibt es beispielsweise Geschwisterarten. Es handelt
sich um Arten, die nicht morphologisch, sehr wohl aber genetisch unterscheidbar
sind.
Die Vielfalt beschränkt sich nicht auf die Zahl der Arten. Auch
innerhalb der Arten gibt es eine Vielfalt.
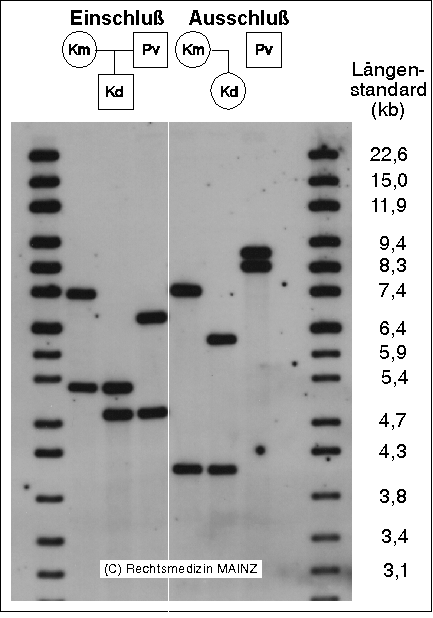
In den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderst wurde die Vielfalt innerhalb
von Tierarten erstmals mittels Elektrophorese bestimmt.
Zu diesem Zweck trennt man Enzyme auf einem Elektrophoresegel auf.
Jede "Bande" auf dem Gel zeigt ein Enzym, das wiederum ein
bestimmtes Allel eines Gens repräsentiert.
Es erhebt sich nun die Frage, warum es innerhalb der Arten
so eine große Vielfalt gibt, wenn doch die Selektion so stark
sein soll.
Zu diesem Zweck betrachten wir die Verteilung von Genen in einer
Population:
Das Hardy-Weinberg-Gesetz:
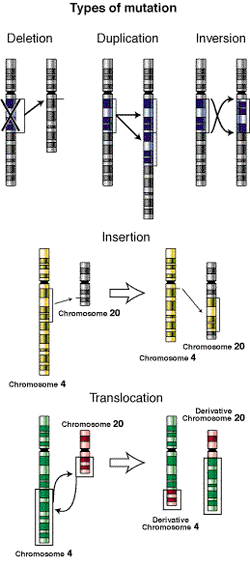
|

