Humangenetik (Einführung)
Bereits die Naturphilosophen der Antike (z. B. Aristoteles) beschäftigten
sich mit der Tatsache, dass Kinder ihren Eltern oder einem Elternteil
äußerlich oft sehr ähnlich sind. Darüber hinaus waren
sie bereits der Meinung, dass auch Eigenschaften und Fähigkeiten
an Nachkommen weitergegeben werden. Allerdings glaubten sie auch an die
Vererbung erworbener Eigenschaften. Auch die Bedeutung der Sexualvorgänge
im Rahmen der Vererbung war ihnen bereits bewusst. Anaxagoras, ein griechischer
Philosoph (500 428 v. Chr.), entwickelte die so genannte Präformationstheorie,
nach der ein Embryo bereits im Sperma vorgeformt wäre und sich in
der Gebärmutter der Frau nur fertigentwickeln würde. Selbst
die Bestimmung des Geschlechts war dabei bereits festgelegt. Man glaubte,
dass Sperma des rechten Hodens männliche, solches des linken Hodens
weibliche Nachkommen hervorbringe.
Die Vorstellungen der Antike beeinflussten bis ins Mittelalter die Ansichten
über das Vererbungsgeschehen beim Menschen. Dies kam in der damals
aufgestellten Homunkulus-Theorie, die ebenfalls einen "Miniaturmenschen"
in den Spermien annahm, klar zum 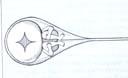 Ausdruck. Ausdruck.
Bild rechts: Spermium mit Homunculus (17. Jh.). Die Nabelschnur wurde
im Spermienschwanz vermutet.
Erst die Fortschritte auf dem Gebiet der Zellenlehre und schließlich
die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen auf dem Gebiet der menschlichen
Erblehre revidierten diese Lehrmeinungen. Große Bedeutung kam den
Arbeiten des Engländers Francis Galton zu (1869). Er beobachtete
vor allem die Weitergabe von körperlichen und geistigen Eigenschaften
unter Verwandten und gilt heute als Begründer der Familienforschung.
Methoden der Humangenetik
Die Familienforschung:
Die Familienforschung zählt sicher zu den ältesten Untersuchungsmethoden
im Rahmen der Erbforschung und kann gewissermaßen als Ersatz für
die Kreuzungsversuche der klassischen Vererbungslehre angesehen werden.
Bei der Erstellung von Stammbäumen und Ahnentafeln ist es möglich,
das Auftreten bestimmter Merkmale über viele Generationen zurückzuverfolgen.
Man vergleicht dabei nicht nur körperliche Merkmale (z. B. "Habsburger-Unterlippe"),
sondern auch geistige und charakterliche Anlagen (z. B. Musikalität,
mathematische Begabung und die Begabung für Naturwissenschaften).
Heute haben Stammbaumanalysen im Rahmen der genetischen Familienberatung,
in die auch andere Analysenmethoden einbezogen werden können, immer
größere Bedeutung. Es geht dabei vorwiegend um die Abschätzung
der Möglichkeit des Auftretens von Anomalien bei den Kindern eines
künftigen Elternpaares.
Die Bedeutung der massenstatistischen Verfahren liegt im Erfassen der
in der Bevölkerung auftretenden Erbkrankheiten. Wichtig sind dabei
die Untersuchungen von Neugeborenen, die im Rahmen der vorgesehenen Untersuchungen
stattfinden. Auf diese Weise erhält man statistisches Material über
die Häufigkeit bestimmter Erbkrankheiten, das wieder die Voraussetzung
für das Treffen gesundheitspolitischer Entscheidungen ist, z. B.
Früherkennungstest auf Phenylketonurie. Man wendet bei diesen Arbeiten
die Erkenntnisse der Populationsgenetik auf den Menschen an und gelangt
über die Untersuchung möglichst vieler Einzelfälle und
deren statistische Auswertung zu aussagekräftigen Ergebnissen.
Die Zwillingsforschung:
Man unterscheidet zwei Arten von Zwillingen. Die zweieiigen Zwillinge,
die sich aus je einer unabhängig voneinander freigegebenen, befruchteten
Eizelle entwickelt haben, und die eineiigen Zwillinge (EZ). Diese gehen
aus einer einzigen Eizelle hervor, die sich nach ihrer Befruchtung, in
den ersten Entwicklungsphasen, noch vor der Einnistung in die Gebärmutter,
in zwei Keime teilt. Das Erbgut beider Keime (Embryos, Feten) stimmt vollkommen
überein, wodurch die sehr große Ähnlichkeit der Zwillinge
erklärt wird. Eine vollkommene Übereinstimmung ist aber auch
bei eineiigen Zwillingen nicht gegeben. Die auftretenden Unterschiede
sind vor allem durch unterschiedliche Umwelteinflüsse bedingt. Dieser
Umstand ist in erster Linie der Ansatzpunkt für die Zwillingsforschung.
Durch die vergleichende Betrachtung von EZ, die unter gleichen oder unterschiedlichen
Umwelteinflüssen gemeinsam oder getrennt aufwuchsen, erhält
man Einsichten in die genetisch- bzw. umweltbedingte Ausbildung von Merkmalen
sowie deren Wechselwirkung. Zu den hauptsächlich durch die Umwelt
geprägten Merkmalen (umweltlabile Merkmale) gehört z. B. das
Körpergewicht, während Körpergestalt und -größe
- ebenso wie die Augenfarbe - genetisch bestimmt werden.
Eine weitere Möglichkeit zur Klärung der Wechselwirkung zwischen
genetischer Veranlagung und Umwelteinflüssen ist der Vergleich einer
möglichst großen Zahl von EZ und ZZ. Stimmen z. B. EZ in einem
untersuchten Merkmal deutlich häufiger überein als die ZZ, dann
weist dies auf ein umweltstabiles, d. h. überwiegend genbestimmtes
Merkmal hin.
Cytogenetische und biochemische Methoden:
Auf dem Gebiet der Zelluntersuchungen konnten die größten
Fortschritte der Humangenetik erzielt werden. Man arbeitet dabei vorzugsweise
mit Kulturen verschiedener weißer Blutkörperchen. An diesen
werden z. B. Chromosomen- und Enzymuntersuchungen durchgeführt.
Auch die mutagene Wirkung von Umweltfaktoren kann an ihnen getestet werden.
Für die Untersuchungen ist die Isolierung und Darstellung der Chromosomen
des Menschen eine notwendige Voraussetzung. Die eindeutige Identifizierung
der Chromosomen erfolgt mit  Hilfe
der Bandentechnik. Man behandelt zu diesem Zweck die Chromosomen in der
Metaphase einer mitotischen Teilung mit speziellen Färbetechniken,
wodurch auf ihnen ein charakteristisches Bandenmuster sichtbar wird.
Anhand dieses Bandenmusters wurden die Chromosomen des Menschen in einem
Karyogramm, d. h. in Gruppen mit international festgelegter Nummerierung,
geordnet. Die Banden werden als Orte der DNS-Sequenzen gedeutet. Aus Veränderungen
der Muster lässt sich auf etwaige Strukturveränderungen der
Chromosomen (Chromosomenmutationen) schließen. Hilfe
der Bandentechnik. Man behandelt zu diesem Zweck die Chromosomen in der
Metaphase einer mitotischen Teilung mit speziellen Färbetechniken,
wodurch auf ihnen ein charakteristisches Bandenmuster sichtbar wird.
Anhand dieses Bandenmusters wurden die Chromosomen des Menschen in einem
Karyogramm, d. h. in Gruppen mit international festgelegter Nummerierung,
geordnet. Die Banden werden als Orte der DNS-Sequenzen gedeutet. Aus Veränderungen
der Muster lässt sich auf etwaige Strukturveränderungen der
Chromosomen (Chromosomenmutationen) schließen.
Ein nächster Schritt war die Bestimmung der Genorte auf den Chromosomen.
Dies gelang mittels der so genannten somatischen Hybridisierung und mit
gentechnischen Methoden.
Das Verfahren der somatischen Hybridisierung beginnt mit der Verschmelzung
von Zellen unterschiedlicher Herkunft (z. B. Zellen aus menschlichen Zellkulturen
und Mauszellen). In diesen Hybridzellen verschmelzen auch die Zellkerne.
Die Hybridkerne enthalten somit die Summe der Gene von Mensch und Maus.
In der Regel produzieren diese Hybridzellen vorerst die Enzyme beider
Ausgangskulturen.
Bild rechts: Karyogramm (schematisch) des Menschen mit den für
die Chromosomen typischen Bandenmustern. Die Färbung erfolgte hier
mit Giemsa-Färbung.
( 1-22: Autosomen. X,Y: Geschlechtschromosomen).
Hybridzellen können sich durch Teilung vermehren. Dabei kommt es
allerdings zu Unregelmäßigkeiten, wodurch Chromosomen oder
Chromosomenteile des langsamer wachsenden Partners, also des Menschen,
verloren gehen. Aus dem Verlust eines Chromosoms (Teilstückes) und
dem Ausfall eines Genprodukts kann in weiterer Folge auf den Sitz des
zugehörigen Gens geschlossen werden. Mit dieser Methode konnten Genorte
(Genloci) beim Menschen gefunden werden.
Bilder: Genetik, Evolution, Mensch und Umwelt (Franz Deuticke)
|

