
|
Die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit ist genauso ein Ergebnis der
natürlichen Auslese wie jedes andere Merkmal von Organismen. Dabei
begünstigt die Selektion im Allgemeinen ein besseres Erkennen der
objektiven Züge der Umwelt, in der unsere vormenschlichen Ahnen lebten.
(Shimony, 1971)
Wenn sich unser Erkenntnisapparat in evolutiver Anpassung an die Umwelt
entwickelt hat, dann sollte sich diese Tatsache in gewissen Passungen
zeigen. Dass dies der Fall ist, wird am Beispiel der optischen Wahrnehmung
besonders deutlich. Die Intensitätsverteilung des Sonnenlichts über
die verschiedenen Wellenlängen folgt etwa dem Planckschen Strahlungsgesetz
(Abb., Kurve 1). Bei einer Temperatur der Sonnenoberfläche von 5800
K liegt das Maximum der Verteilung bei 510 nm. Die Atmo-sphäre ist
für diese Strahlung nur bedingt durchlässig. So werden die Röntgen-
und UV-Strahlen bereits in den höheren, die Infrarotstrahlern in
erdnahen Luftschichten stark absorbiert. Nur für die Strahlung zwischen
400 und 800 nm (und für Radiowellen) hat die Atmosphäre ein
"Fenster" (Abb., Kurve 2).
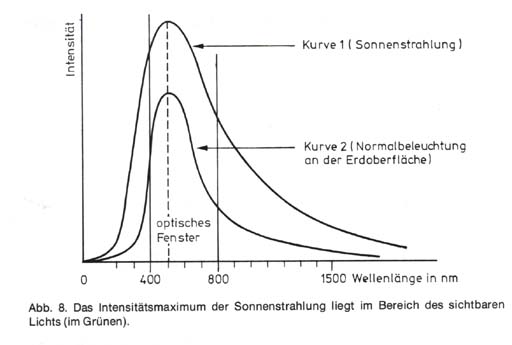
Dieses Fenster stimmt mit dem "optischen Fenster" unserer Wahrnehmung
(380-760 nm) praktisch überein. Unser Auge ist also gerade für
den Ausschnitt empfindlich, in dem das elektromagnetische Spektrum ein
Maximum zeigt. Dieses Maximum liegt für uns im Gelbgrün, also
etwa in der Mitte der Spektralfarben.
Es ist nicht so, dass "ausgerechnet" der sichtbare Ausschnitt
des Sonnen-spektrums unsere Atmosphäre durchstrahlen kann. Natürlich
ist es genau umgekehrt so, dass der vergleichsweise winzige Ausschnitt
aus dem breiten Frequenzbereich der Sonnenstrahlung, der zufällig
in der Lage ist, die irdische Atmosphäre zu durchstrahlen, eben aus
diesem Grunde für uns zum sichtbaren Bereich dieses Spektrums, zu
"Licht" geworden ist.
(v. Ditfurth, 1972)
Es ist allerdings ein glücklicher Zufall, dass optische Transparenz
und mechanische Penetrabilität praktisch zusammenfallen (Campbell,
1974). Feste Körper sind undurchsichtig und undurchdringlich, Luft
und Wasser dagegen durchsichtig und durchdringbar. Diese Übereinstimmung
gilt bei anderen Wellenlängen nicht, stellte also einen starken zusätzlichen
Selektionsfaktor dar. Glas und Nebel haben unter diesem Gesichtspunkt
paradoxe Eigenschaften: Glas ist hart, aber durchsichtig, für Nebel
gilt gerade das Gegenteil. Glas spielte aber für die Evolution sicher
keine, Nebel nur eine untergeordnete Rolle.
Das Auge hat sich jedenfalls auf die optimale Ausnützung des Tageslichtes
eingestellt. Vor der menschlichen Kultur war ja die Sonne die einzige
in der Selektion wirksame Lichtquelle; Feuer, Mond- und Sternenlicht hatten
sicher nur geringe Bedeutung. Auch bei Tieren liegt das "optische
Fenster" im gleichen Bereich. Es mag etwas verschoben sein wie bei
Bienen; aber immer wird der günstigste Wellenlängenbereich des
Tageslichtes ausgenützt.
An dieser Feststellung ändert auch die Tatsache nichts, dass Pythons
(Riesenschlan-gen) und Klapperschlangen neben gewöhnlichen Augen
noch "Infrarotaugen" besitzen, mit denen sie Wärmestrahlung,
vor allem die ihrer warmblütigen Opfer, "erspüren";
denn diese Augen dienen ja gerade nicht dem Sehen von Tageslicht.
Nur diese Passung bleibt übrig von der alten Auffassung, das Auge
sei sonnengleich, wie sie Plotin, die Lichtmetaphysiker oder Goethe vertreten
haben: Wäre nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie
erblicken (Goethe: Zahme Xenien 3, und Einleitung zur Farbenlehre).
Nicht weil das Auge primär sonnenhaft ist, kann es die Sonne
erblicken, sondern weil es sich in jahrmilliardenlanger Stammesentwicklung
in einer Welt herausgebildet hat, in der eine reale Sonne schon Äonen
vor dem Vorhandensein von Augen ihre Strahlen aussandte. (Lorenz, 1943)
Man weiß von mehreren Insekten (Bienen, Libellen), von einigen
Fischen, Reptilien, Vögeln, Affen und vom Menschen, dass sie Farben
unterscheiden können. Über die Evolution des Farbenkreises hat
Schrödinger schon 1924 eine einleuchtende Vermutung geäußert:
"Zunächst wird Licht überhaupt, d. h. noch ohne jede farbliche
Differenzierung, wahrgenommen.
Dass uns die Mischung aller Regenbogenfarben als "weißes"
Licht, genauer farblos erscheint, zeigt gerade den Passungscharakter unserer
Farbwahrnehmung. Für den Wahrnehmungsapparat war es eben biologisch
sinnvoll, die normale Beleuchtung an der Erdoberfläche als farblich
neutral zu interpretieren und nur Abweichungen von der normalen Zusammensetzung
des Lichtes als Farbe bewusst zu machen.
Auch für die spektrale Empfindlichkeit der Lichtsinneszellen (verschiedene
Wellenlängen werden trotz gleicher Reizintensität verschieden
stark empfunden) und für das Farbunterscheidungs-(Auflösungs-)
Vermögen des Auges gibt es evolutionistische Erklärungen."
Die untere Empfindlichkeitsschwelle eines Photorezeptors in der Retina
liegt bei einem einzigen Lichtquant (10-18 Joule). Das Nervensystem
meldet aber nur dann eine Lichtempfindung, wenn innerhalb kurzer Zeit
mehrere benachbarte Sehzellen gereizt werden. Diese Einrichtung ist eine
Schutzmaßnahme gegen die unvermeidlichen Störungen und statistischen
Schwankungserscheinungen (das sog. "Rauschen"), wie sie wegen
des Quantencharakters der Strahlung auch bei hochempfindlichen Geräten
immer auftreten. Würde nun jedes Quant registriert, so hätten
wir fortwährend regellose Lichteindrücke ohne jeden Informationsgehalt.
Diese bedeutungslosen Signale werden also durch die Zensur des Nervensystems
ausgeschieden.
Analog verhindert beim Ohr ein "Filter", dass die aufgrund
der Brownschen Molekularbewegung gegen das Trommelfell prasselnden Moleküle
als Geräusche interpretiert werden. Das erinnert sehr an Ciceros
Behauptung im "Somnium Scipionis" (De re publica), wir könnten
die Harmonie der Sphären nicht vernehmen, weil unsere Ohren sich
zu sehr daran gewöhnt hätten!
Ein schönes Beispiel ist auch das zeitliche Auflösungsvermögen
unseres Bewusstseins. Den Zeitabstand, den zwei Ereignisse haben müssen,
damit sie noch sicher als aufeinander folgend (also nicht als gleichzeitig)
wahrgenommen werden, nennt man das subjektive Zeitquant (SZQ). Das SZQ
beim Menschen beträgt etwa 1/16 Sekunde. Folgen einander mehr als
16 Lichtblitze pro Sekunde, so kann sie unser Auge nicht mehr getrennt
wahrnehmen, sondern sie erzeugen den Eindruck dauernder Helligkeit. Diese
Tatsache benützen ja gerade Film und Fernsehen, um eine kontinuierliche
Szene und Bewegung vorzutäuschen. Periodische akustische Reize, die
rascher aufeinander folgen als 16mal pro Sekunde, verschmelzen subjektiv
zu einem Ton. Analoges gilt für Berührungsreize.
Die Informationspsychologie deutet das SZQ als das Intervall, in dem
die Informationseinheit (ein bit) in das Kurzzeitgedächtnis fließt
(Frank, 1970).
Das SZQ ist von Tierart zu Tierart verschieden. Der Kampffisch z. B.
greift sein eigenes Spiegelbild an, wenn es ihm - durch eine geschickte
mechanische Vorrichtung - öfter als 30mal pro Sekunde vorgeführt
wird; unterhalb dieser Frequenz erkennt er sein Bild nicht als Gegner
an, es "flimmert" für ihn. Er verarbeitet also eine größere
Zahl von optischen Eindrücken pro Sekunde. Man nennt solche Tiere
deshalb bildhaft "Zeitlupentiere". Das SZQ der Biene ist
noch wesentlich kürzer. Gäbe es im Bienen-staat ein Kino, so
müsste der Filmprojektor sehr schnell arbeiten.
Mehr als 200 Einzelbildchen in jeder Sekunde müssten den Bienen
vorgeführt werden, damit sie sich nicht über "Flimmern"
beklagen. Das Auge der Bienen kann in der gleichen Zeit etwa 10 mal so
viele Einzeleindrücke wahrnehmen als unser Auge. Es ist dadurch zum
Sehen von Bewegungen besonders tauglich und glänzend geeignet, die
rasch wechselnden Eindrücke zu erfassen, wenn an sich ruhende Dinge
im Fluge an ihren Augen vorüberziehen.
(v. Frisch, 1969)
Andererseits ist das SZQ einer Schnecke länger als ¼ Sekunde.
Ein Stock, der sich ihr viermal pro Sekunde nähert, erscheint ihr
in Ruhe, und sie versucht, ihn zu besteigen. Sie ist also ein "Zeitraffer-Tier".
Die sensorischen Systeme der Tiere sind so angepasst, dass sie im
Großen und Ganzen die Informationen übermitteln, welche für
die Lebensweise ihrer Besitzer wichtig sind.
(Gregory, 1972)
Dieser Passungscharakter der Sinneswahrnehmung wird besonders deutlich
an Fehlleistungen und Verfälschungen, die in einer fremden Umgebung
auftreten. Ein Frosch verhungert inmitten toter Fliegen, weil sie sich
nicht bewegen. Unter Wasser sehen wir alles verzerrt, weil unser Auge
dem Brechungsindex der Luft angepasst ist. Um den "normalen"
Übergang Auge-Luft wiederherzustellen, müssen wir Taucherbrillen
benützen.
Ähnlich ist das Trommelfell auf die großen Amplituden der
Luftschwingungen eingerichtet. In Wasser, wo die Schallschwingungen viel
geringere Amplituden haben, hören wir deshalb alles viel leiser.
Daraus entstand auch die irrige Annahme, Fische seien stumm. In Wahrheit
gibt es kaum einen Fisch, der keine Laute von sich gibt. Da die Atemluft
eines Tauchers unter Wasser stark verdichtet ist, klingt seine Stimme
näselnd und gepresst, wie Meeresforscher (z. B. Cousteau) berichten.
Aber nicht nur an die Dichte, sondern auch an die Zusammensetzung der
Luft sind Ohr und Stimme angepasst:
Bekanntlich nimmt die Stimme eines Menschen, der in einer Sauerstoff-Helium-Atmosphäre
spricht, wie sie für Tieftauchversuche verwendet wird, ganz unvermeidbar
einen quäkenden, "mickymausartigen" Klang an. In einer
solchen Atmosphäre, in der Helium den normalerweise in der Atmosphäre
enthaltenen Stickstoff ersetzt, ändert sich vor allem die Geschwindigkeit
des Schalls. Damit ändern sich auch die Resonanzeigenschaften der
Luft, welche beim Sprechen mit den im Kehlkopf befestigten Stimmbändern
in Schwingungen versetzt wird. Bau und Abmessungen unseres Kehlkopfes
sind aber nun eben an die Eigenschaften der normalen Atmosphäre angepasst.
(v. Ditfurth, 1972)
Der Passungscharakter unserer dreidimensionalen Raumwahrnehmung spiegelt
sich vor allem in der Entdeckung der Verhaltensforschung, dass manche
Tiere eine "schlechtere" Raumwahrnehmung besitzen als wir.
Organismen aus wenig strukturierten Lebensräumen bedürfen eines
weniger genauen und differenzierten Orientierungsverhaltens als solche,
die sich auf Schritt und Tritt mit komplizierten räumlichen Gegebenheiten
auseinandersetzen müssen. Der homogenste aller Lebensräume ist
die Hochsee, und in dieser gibt es denn auch einzelne freibewegliche Lebewesen,
die eigentlicher Orientierungsreaktionen völlig entbehren [z. B.
Quallen . . .]
In zwei Dimensionen ist die Steppe gewissermaßen das, was die Hochsee
in dreien ist. Es gibt selbst unter den steppenbewohnenden Vögeln
und Säugetieren solche, die ein senkrechtes Hindernis nicht verstehen
und nicht einmal durch Lernen zu bewältigen vermögen.
(Lorenz, 1954)
Die Tiere, die auf ihren täglichen Wegen die kompliziertesten räumlichen
Strukturen meistern, sind die Baumbewohner und unter diesen wieder diejenigen,
die nicht mit Krallen oder Haftscheiben, sondern mit Greifhänden
klettern. Bei ihnen müssen nicht nur Richtung, sondern auch Entfernung,
Lage und Form des Sprungzieles schon vor dem Absprung ganz genau im zentralen
Nervensystem des Tieres repräsentiert sein. Denn die Greifhand muss
sich in der richtigen Raumlage und genau im richtigen Moment schließen."
Der Mensch verdankt seine vergleichsweise gute Raumwahrnehmung also eigentlich
seinen Vorfahren, die als Baumbewohner und Greifkletterer auf eine gute
zentrale Repräsentation ihrer dreidimensional strukturierten Umgebung
angewiesen waren. Diese Tatsache führt aber unmittelbar auf eine
noch weiter gehende Vermutung, die im Kapitel "Evolution der Erkenntnisfähigkeit"
als Hypothese formuliert werden soll.
Quelle (mit Bild): Gerhard Vollmer: "Evolutionäre Erkenntnistheorie" Verlag S. Hirzel, Stuttgart.
(mit Erlaubnis des Autors)
v. Ditfurth, H.: "Im Anfang war der Wasserstoff, Hoffmann &
Campe, 1972
v. Frisch, K.: "Aus dem Leben der Bienen", Springer-TB,
1969
Gregory, R. L.: "Auge und Gehirn", Fischer-TB, 1972
Lorenz, K.: "Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung."
Z. Tierpsychologie", 1943
Lorenz, K.: "Psychologie und Stammesgeschichte" in "Über
tierisches und menschliches Verhalten II", Piper, 1954
Shimony, A.: "A perception from an evolutionary point of view.",
J. Philosophy, 1971)
|

